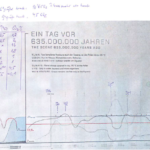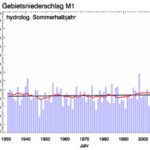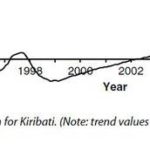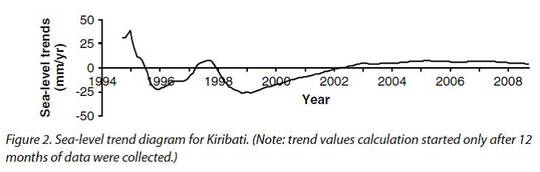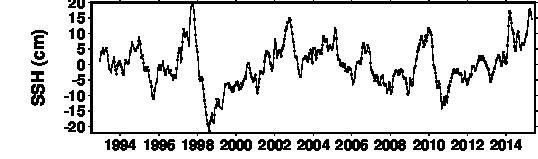Neue Studie: Treibhausgase verursachen beim gegenwärtigen Temperaturniveau der Erde ABKÜHLUNG, nicht Erwärmung

Diese Ergebnisse sind nicht kompatibel mit der Arrhenius/IPCC-Theorie bzgl. der Strahlungseigenschaften von Treibhausgasen, welche postuliert, dass Strahlungsantrieb durch Treibhausgase immer eine positive Rückkopplung und damit einen ,Treibhaus‘-Erwärmungseffekt verursacht hat, und zwar bei allen Temperaturen der Erde und Treibbausgaskonzentrationen.
Die Ergebnisse dieser Studie jedoch, die zeigt, dass Treibhausgase einen vernachlässigbaren oder sogar abkühlenden Effekt auf die Temperaturen der Erde haben, sind kompatibel mit Maxwell/Clausius/Carnot gravito-thermal greenhouse theory, der HS ‚greenhouse equation,‘ Chilingar et al, Kimoto, Wilde und anderen.
Auszüge aus den Ergebnissen der Autoren:
„Kurzwellige (solare) Strahlung ist eine starke positive Rückkopplung bei niedrigen Temperaturen, die sich mit steigenden Temperaturen immer mehr abschwächt. Langwellige Strahlung (durch Treibhausgase) ist eine negative Rückkopplung bei niedrigen Temperaturen (288K oder ca. 15°C). Diese wird jedoch bei Temperaturen über 295K bis 300 K [ca. 22 bis 27°C) zu einer positiven Rückkopplung. (Die gegenwärtige Temperatur der Erde beträgt 288K oder 15°C).
Jüngst wurde darauf hingewiesen, dass einige Zustände konvektiver Organisation aus einer Instabilität des Hintergrund-Zustandes des Gleichgewichts zwischen Strahlung und Konvektion resultieren könnten, was zu einer Unterteilung der Atmosphäre in feuchte Regionen mit Hebung und trockenen Regionen mit Absinken führt (Emanuel et al. 2014). Falls eine solche Instabilität tatsächlich existiert in der realen (nicht der modellierten!) Atmosphäre, würde dies unser Verständnis tropischer Zirkulationen umgestalten. Außerdem könnte sie helfen, Wachstum und Lebenszyklus großräumig organisierter konvektiver Systeme zu erklären wie die tropischen Zyklone und die Madden-Julian-Oszillation (z. B. Bretherton et al. 2005; Sobel und Maloney 2012). Falls diese Instabilität temperaturabhängig ist, wie es aus numerischen Modellstudien hervorgeht (Khairoutdinov und Emanuel 2010; Wing und Emanuel 2014; Emanuel et al. 2014), dann könnte die zunehmende Tendenz konvektiver Systeme, sich mit Erwärmung zu organisieren, auch die Klimasensitivität signifikant verändern (Khairoutdinov und Emanuel 2010). Es ist unklar, ob die gegenwärtigen globalen Klimamodelle diesen Prozess angemessen berücksichtigen (beschrieben auch hier).
Ist das Phänomen der Selbst-Aggregation in einem Modell mit einem Abstand der Gitterpunkte von 200 km X 200 km und expliziter Konvektion und Wolken das Gleiche wie in einem Modell mit Gitterpunksabständen von 20.000 km X 20.000 km, wobei Konvektion und Wolken parametrisiert sind? Diese Frage ist weitgehend unbeantwortet. Jedoch ist eine Antwort auf diese Frage unabdingbar, falls wir die Stärke von Selbst-Aggregation unserer Modellhierarchie und dessen Relevanz für die reale Atmosphäre verstehen wollen.
In allen Simulationen erwärmt sich die Troposphäre und trocknet aus relativ zu den Ausgangsbedingungen, obwohl sich die Stratosphäre in den Simulationen abkühlt, in denen Ts unter 300 K liegt. Die troposphärische Erwärmung insgesamt und die Zunahme der troposphärischen Erwärmung mit Ts sind konsistent mit dem Ergebnis von Singh und O’Gorman (2013), dass die Temperaturabnahme mit der Höhe in RCE [?] vom Entrainment [Einströmen von Luft von der Seite in konvektive Bewölkung. Anm. von Hans-Dieter Schmidt] abhängt sowie von der Relativen Feuchtigkeit in der freien Troposphäre. In unseren Simulationen lässt Aggregation die Relative Feuchtigkeit abnehmen, wohingegen die Relative Feuchtigkeit in der freien Troposphäre in konvektiv aktiven Gebieten zunimmt. Dies reduziert auf plausible Weise den Einfluss von Entrainment auf die vertikale Temperaturabnahme und treibt die thermische Struktur der Troposphäre mehr in die Nähe einer Feuchtadiabate. Die Erwärmung der Troposphäre durch Aggregation kann auch erklärt werden als Konsequenz konvektiver Vorgänge in feuchten Gebieten, in denen Luft mit höherer feuchtstatischer Energie innerhalb der Grenzschicht angezogen wird (Held et al. 1993).
Die mittlere langwellige Ausstrahlung nimmt zu mit jeder Simulation als Folge dieses Austrocknens, und zwar mit einer Menge, die mit Ts zunimmt. Der Bereich: ∼ 11 W/m² bei 280 K bis ∼24 W/m² bei 310 K.
Die eingefrorene feuchtstatische Energie (hiernach als h bezeichnet) wird in trockenen und feuchtadiabatischen Dislokationen [displacements] konserviert, ebenso wie Gefrieren und Schmelzen von Niederschlag; h wird bestimmt durch die innere Energie cp T, die Gravitationsenergie gz und die latente Energie Lvq – Lf qc,i (cp ist die spezifische Wärme trockener Luft bei konstantem Luftdruck, und g ist die Gravitationsbeschleunigung). Im Term der latenten Energie ist Lv die latente Wärme der Verdampfung, q ist das Wasserdampf-Mischungsverhältnis, Lf ist die latente Wärme der Fusion und qc,i ist das kondensierte Wasser-Eis-Mischungsverhältnis:
h = cpT + gz + Lvq − Lf qc,i.
Atmosphärische Erwärmung und Abkühlung führen jeweils zu Feuchtezunahme und Austrocknung, weil die schwache Temperaturgradient-Approximation impliziert, dass anomale Erwärmung großenteils durch Hebung ausgeglichen wird, wobei Feuchtigkeit in die Luftsäule konvergiert, während anomale Abkühlung hauptsächlich durch Absinken ausgeglichen wird, was Feuchtigkeit aus der Luftsäule entfernt.
In den vier kältesten Simulationen (TS = 280 K, 285 K, 290 K, 295 K) ist die langwellige Strahlung zuallererst eine negative Rückkopplung, aber in wärmeren Simulationen (>295 K) ist sie eine wichtige positive Rückkopplung. Die Magnitude der kurzwelligen Rückkopplung nimmt um fast einen Faktor 10 ab, wenn die Temperatur an der Oberfläche von 280 K auf 310 K steigt, und die kurzwellige Rückkopplung wird auch viel weniger wichtig relativ zu anderen Rückkopplungen.
Obwohl des Verhalten des Terms der Langwellenstrahlung-Rückkopplung in unseren Simulationen konsistent zu sein scheint mit der von Emanuel et al. (2014) gezeigten Temperaturabhängigkeit, führen Wolkeneffekte eher als Strahlungstransfer bei klarem Himmel zu unserer negativen Langwellen-Rückkopplung bei geringen Werten von Ts. Wie von Emanuel et al. (2014) vorhergesagt ist die Langwellen-Rückkopplung bei klarem Himmel in kälteren Simulationen schwächer – nahe Null oder leicht negativ – aber dies leistet nur einen kleinen Beitrag zur gesamten langwelligen Rückkopplung. Aggregation findet statt trotz einer initial negativen langwelligen Rückkopplung bei Ts <= 295 K, weil diese negative Rückkopplung überkompensiert wird durch eine Kombination eines positiven Oberflächenfluss und kurzwellige Rückkopplungen; man erinnere sich, dass die zunehmende Stärke der kurzwelligen Rückkopplung mit abnehmender Temperatur weitgehend den Wolken geschuldet ist.
Eine negative langwellige Wolken-Rückkopplung impliziert, dass die Atmosphäre selbst sich in feuchten Gebieten mehr und in trockenen Gebieten weniger abkühlt infolge der Gegenwart von Wolken. Wir spekulieren, dass dies so ist, weil eine kältere Atmosphäre optisch dünn ist, so dass das Hinzufügen von Wolken die langwellige atmosphärische Abkühlung durch Zunahme seiner Emissivität zunehmen lassen kann. Die langwellige Strahlungs-Rückkopplung zu Beginn der Simulation wird negativ, wenn Ts abnimmt, was durch eine Zunahme der Magnitude der kurzwelligen Strahlungs-Rückkopplung kompensiert wird.
Self-aggregation of convection in long channel geometry
Allison A. Wing1,* and Timothy W. Cronin2
ABSTRACT:
Wolkenbedeckung und Relative Feuchtigkeit in den Tropen werden durch organisierte atmosphärische Konvektion stark beeinflusst. Diese findet in räumlich und zeitlich breit gestreuten Maßstäben statt. Eine Art der Organisation, die bei idealisierter numerischer Modellierung gefunden wird, ist Selbst-Aggregation, ein spontaner Übergang von zufällig verteilter Konvektion zu organisierter Konvektion trotz homogener Grenzschicht-Bedingungen. Wir erkunden den Einfluss der Bereichsgeometrie [?] auf das Phänomen, Wachstumsraten und den Maßstab der zeitlichen Dauer der Selbst-Aggregation tropischer Konvektion. Wir simulieren strahlungs-konvektives Gleichgewicht mit dem System for Atmospheric Modeling (SAM) in einem nicht rotierenden, lang gestreckten 3D-Kanal mit einer Länge von 10↑4 km mit interaktiver Strahlung und Oberflächenflüssen und festgelegter Wassertemperatur, die von 280 K bis 310 K variiert. Konvektive Selbst-Aggregation erfolgt in multiplen Bändern feuchter und trockener Luft über diesen Kanal. Mit der Aggregation der Konvektion finden wir eine Abnahme des hochtroposphärischen Wolkenanteils, jedoch eine Zunahme des Anteils tiefer Wolken. Diese Sensitivität der Wolken bzgl. Aggregation passt zu Beobachtungen der oberen Troposphäre, aber nicht in der unteren Troposphäre. Ein Vorteil der Kanal-Geometrie ist, dass eine trennende Distanz zwischen konvektiv aktiven Regionen definiert werden kann. Wir präsentieren eine Theorie hinsichtlich dieser Distanz auf der Grundlage einer Wiederanfeuchtung der Grenzschicht. Aber die Advektion feuchtstatischer Energie agiert als negative Rückkopplung und wirkt der Selbst-Aggregation entgegen, bei fast allen Temperaturen und Zeitperioden. Am Anfang des Prozesses der Selbst-Aggregation sind Oberflächenflüsse eine positive Rückkopplung bei allen Temperaturen, kurzwellige (solare) Strahlung ist eine starke positive Rückkopplung bei geringen Oberflächentemperaturen, die aber bei höheren Temperaturen schwächer wird. Langwellige Strahlung (durch Treibhausgase) ist bei niedrigen Temperaturen eine negative Rückkopplung, wird jedoch zu einer positiven Rückkopplung bei Temperaturen über 295 bis 300 K (die gegenwärtige Temperatur der Erde beträgt 288 K). Wolken tragen stark zu den negativen Rückkopplungen bei, vor allem bei niedrigeren Temperaturen (< 295 K).
Link: http://hockeyschtick.blogspot.de/2015/07/new-paper-finds-greenhouse-gases.html
Übersetzt von Chris Frey EIKE