Elektro-Energiespeicherung, Notwendigkeit, Status und Kosten. Teil 3 (Abschluss)
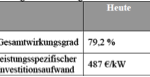
Teil 3
1 Pumpspeicher
1.1 Allgemeine Betrachtung
Niedersachsen-Studie 2014[1]
Für einen wirtschaftlichen Betrieb wird meist von einer Mindestfallhöhe von 200 m ausgegangen. Durch ihre kurze Anfahrdauer von ca. ein bis zwei Minuten bis Volllast können PSW sowohl zur Bereitstellung von Regelenergie (zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität) als auch zur Speicherung von Energie verwendet werden. Dennoch zählen Pumpspeicherwerke mit einem Wirkungsgrad von ca. 80 % zu den großtechnischen Speichertechnologien mit dem höchsten Wirkungsgrad.
Trotz der guten Expertise braucht man Pumpspeichersysteme eigentlich nicht weiter zu betrachten.
Grund: Sie sind in Deutschland nicht im Entferntesten im erforderlichen Maß ausbaubar, in den Alpen ebenso wenig und dass es die Norweger für uns bei sich zulassen würden, kann sich auch als Illussion herausstellen.
Im VCI Zwischenbericht 2013[7] steht zum Thema Norwegen
In öffentlichen Diskussionen wird empfohlen, transnationale Kooperationen z.B. mit den Alpenländern oder Skandinavien anzustreben. Bevor diese Speicherkapazitäten jedoch genutzt werden könnten, wäre zuvor ein erheblicher Ausbau der Stromnetze auf der Höchstspannungsebene erforderlich. Dabei sind allerdings die technischen Grenzen der Stromübertragung und der Stromaufnahme zu beachten
Auch auf der Kraftwerksseite wäre im Ausland eine entsprechende Ausbau notwendig, da die elektrische Leistung der in Norwegen installierten Wasserkraftwerke weniger als 30 GW beträgt, die fast vollständig von Norwegen selbst benötigt wird, so dass die Nutzungsmöglichkeiten für Deutschland entsprechend eingeschränkt sind. Außerdem zeigen die Diskussionen – beispielsweise in Norwegen, dass bei einem weiteren Ausbau mit erheblichem politischem Widerstand zu rechnen sein dürfte.
Forschungsstand
Forschung ist nicht mehr erforderlich, da weder Kosten noch Wirkungsgrad signifikant verbessert werden können.
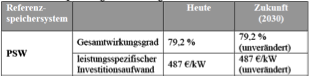
Bild Wirkungsgrad, Quelle Niedersachsen-Studie 2014[1]
1.2 Pumpspeicher Speicherkosten
Hartmann et al.[24] listet:
Stromspeicherkosten für ein als Tagesspeicher ausgelegtes Pumpspeicherwerk:
9 €ct/kWh bei Strombezugskosten von 4,8 €ct/kWh
Eigene Zufügung: ca. 19,25 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 13 €ct/kWh
Kosten Speicherkraftwerk als „saisonaler Speicher“. Da die Kosten der Speicherbecken je nach örtlichen Gegebenheiten stark variieren können, wird für saisonale Speicher von spezifischen
Stromspeicherkosten in einem Bereich von:
· 11 bis 28 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 4,8 €ct/kWh ausgegangen.
Eigene Zufügung: ca. 21,2 bis 38 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 13 €ct/kWh
Fazit
Dieser billigste aller Speicher erhöht den Strompreis deutlich. Bei ungünstiger Betriebsart kann er selbst bei heutigen EEG-Einspeisekosten diese fast verdoppeln. Wird der Ökostrom billiger, erhöht sich der Speicher-Kostenanteil. Vergleicht man die Kosten des aus Pumpspeichern zurück gespeisten Ökostroms mit den Abgabepreisen konventioneller Kraftwerke, sieht man deutlich die Verteuerungen.
2 Druckluftspeicher
2.1 Allgemeine Betrachtung
Niedersachsen-Studie 2014[1]
Der Wirkungsgrad eines Druckluftspeichers liegt bei einem diabaten System zwischen
42 bis 54 %. Bei einem adiabaten Druckluftspeicher kann der Wirkungsgrad auf bis zu 70 % erhöht werden. Beide Systeme werden typischerweise als Kurzzeitspeicher ausgelegt und betrieben.
Anm.: Da beim adiabaten Speicher die Wärme mit hohen Temperaturen von 600 … 800 ºC zwischengespeichert werden muss, funktioniert dies nur bei Kurzzeitspeicherung.
POTENZIALE
Niedersachsen-Studie 2014[1]. Salzvorkommen, die sich zur Nutzung als Kavernenspeicher eignen, sind überwiegend in Nord- und Mitteldeutschland gelegen… Eine erste Potenzialabschätzung nennt für die gesamte Speicherkapazität (v. a. in Salzstöcken in Norddeutschland) einen Wert von etwa 3,5 TWh.
Hartmann et al. 2012 [24]. Durch die Verbesserungen des Wirkungsgrades und die Einsparungen durch den vermiedenen Einsatz von Erdgas in der Turbine wird die adiabate Druckluftspeichertechnologie als zukünftige Alternative zu herkömmliche Pumpspeicherwerken gesehen.
Forschungsstand
TAB 2012[21], STAND DER TECHNIK, ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN
Ein konventionelles CAES mit 321 MW Leistung, mit einer Speicherkapazität ausreichend für einen maximal zweistündigen Volllastbetrieb, wird seit 1978 in Elsfleth-Huntorf (Niedersachsen) von E.ON betrieben.
Adiabate CAES (AA-CAES) befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium, da geeignete Wärmespeicher (benötigte Kapazität etwa 1.200 MWh (thermisch) bei 600 °C) noch nicht verfügbar sind und der Kompressor- bzw. der Turbinenstrang noch einer substanziellen Weiterentwicklung bedürfen.
2.2 Druckluftspeicher Speicherkosten
Hartmann et al.[24] listet:
Die Kostenabschätzung bezieht sich dabei auf den Stand heute (2010) für die diabate Druckluftspeichertechnik und auf das Jahr 2030 für die adiabaten Druckluftspeicher.
Aktuell verfügbare diabate Druckspeicher (Wirkungsgrad 42 .. 54 %)
Stromspeicherkosten für Druckluftspeicher im Tagesspeicherbetrieb:
Stromspeicherkosten ca. 13 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 4,8 €ct/kWh
· Eigene Zufügung: ca. 19,25 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 13 €ct/kWh
Stromspeicherkosten für Druckluftspeicher im saisonalen Betriebe:
· Stromspeicherkosten zu 14 €ct/kWh ohne Strombezugskosten
· 28 €ct/kWh mit Strombezugskosten 4,8 C / kWh
· Eigene Zufügung: ca. 46,5 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 13 €ct/kWh
Im Jahr 2030 für adiabate Druckspeicher (Wirkungsgrad 70 %)
Stromspeicherkosten für Druckluftspeicher im Tagesspeicherbetrieb:
· 12 €ct/kWh mit Strombezugskosten 4,8 C / kWh
· Eigene Zufügung: ca. 23,5 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 13 €ct/kWh
Stromspeicherkosten für Druckluftspeicher im saisonalen Betriebe:
· 21 €ct/kWh mit Strombezugskosten. 4,8 C / kWh
· Eigene Zufügung: ca. 32,5 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 13 €ct/kWh
Fazit
Auch diese hoffnungsvolle Groß-Speichertechnologie erhöht den Ökostrompreis erheblich. Mindestens führt sie zur Verdopplung und falls der Ökostrom-Bezugspreis einmal in die Nähe von früherem Kraftwerksstrom kommen sollte, zur Vervielfachung.
3 Wasserstoffspeicher
3.1.1 Allgemeine Betrachtung
Niedersachsen-Studie
Niedersachsen-Studie 2014[1]. Bei einem Einsatz als Langfristspeicher hingegen stellen Wasserstoffspeicher die klar vorteilhafteste Technologie dar. Soll in Zukunft Strom im großen Maßstab über längere Zeit (in Langfristspeichern) gespeichert werden, so geht trotz der unbestritten vorhandenen Nachteile (niedriger Wirkungsgrad und hoher leistungsspezifischer Investitionsaufwand) auch unter ökonomischen Gesichtspunkten kein Weg an Wasserstoffspeichern vorbei.
Speicherverfahren (P2P)
Zur Gas-Speicherung mit Rückverstromung verwendet man die folgenden Hauptverfahren:
· Strom > Wasserstoff > Strom (P2H2). Der Wasserstoff wird in Kavernen gespeichert. Pfad 1
· Strom > Wasserstoff > Methanisierung > Strom (P2G). Das Methan kann im öffentlichen Gasnetz gespeichert werden. Pfad3
In der Niedersachsen-Studie 2014[1] werden alle Wasserstoff-Speicherarten beschrieben. In dieser Darstellung beschränken wir uns auf den Wasserstoff-Speicher mit direkter Rückverstromung.
Forschungsstand
Niedersachsen-Studie 2014[1]. Der typische Leistungsbereich liegt bei der derzeit einzig kommerziell betriebenen Anlage von Audi bei 6 MW. Es wird davon ausgegangen, dass in Zukunft Speicher mit bis zu 300 MW Leistung realisierbar sind.
TAB 2012[21]. Die Rückverstromung von reinem Wasserstoff in Gasturbinen ist bislang noch nicht möglich, eine Beimischung von etwa 50 bis 60 % Erdgas ist erforderlich. An der Entwicklung geeigneter Gasturbinen wird derzeit gearbeitet, ab etwa 2017 könnten diese zur Verfügung stehen. Ein zweites wichtiges Feld für Forschung und Entwicklung ist die Steigerung der Effizienz des Elektrolyseurs.
Wirkungsgrade
· In Hartmann et al. 2012[24] ist der Wirkungsgrad der Gesamtkette einer Wasserstoffverstromung (P2H2) mit aktuell 42 %, Zukunft 45 % angegeben.
· Niedersachsen-Studie 2014[1]. Der Wirkungsgrad mit Methanisierung (P2P) ist mit aktuell 21,3 %, in der Zukunft 36 % angegeben.
3.2 Wasserstoffspeicher Speicherkosten
Speicherkosten für Verfahren ohne Methanisierung. Basisquelle: Hartmann et al. 2012[24]
Stand heute
Tagesausgleich-Betrieb
· Stromeinspeisungskosten von ca. 26 €ct/kWh mit Strombezugskosten von
4,8 €ct/kWh
· Eigene Zufügung: ca. 46 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 13 €ct/kWh
Saisonal-Betrieb
· Stromeinspeisungskosten von ca. 27 €ct/kWh mit Strombezugskosten von
4,8 €ct/kWh
· Eigene Zufügung: ca. 47 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 13 €ct/kWh
Stand Zukunft
Tagesausgleich-Betrieb
· Stromeinspeisungskosten von 19 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 4,8 €ct/kWh
· Eigene Zufügung: ca. 33 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 13 €ct/kWh
Saisonal-Betrieb
· Stromeinspeisungskosten von 20 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 4,8 €ct/kWh
· Eigene Zufügung: ca. 33 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 13 €ct/kWh
Fazit
Auch das hoffnungsvolle Wasserstoff- Speichern erhöht den Ökostrompreis erheblich. Mindestens führt es zur Verdopplung und falls der Ökostrom-Bezugspreis einmal in die Nähe von früherem Kraftwerksstrom kommen sollte, zur Vervielfachung.
3.3 Wasserstoff mit Methanisierung, Speicherkosten
Speicherkosten. Basisquelle: Niedersachsen-Studie 2014[1].
Stand Zukunft
Tagesausgleich-Betrieb
· Stromeinspeisungskosten von 28 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 4,8 €ct/kWh
Saisonal-Betrieb
· Stromeinspeisungskosten von 29 €ct/kWh mit Strombezugskosten von 4,8 €ct/kWh
Ergänzungsinfo
Um zu zeigen, wie erheblich sich die Kostenangaben unterscheiden, Informativ noch eine Kostenangabe, leider ohne nachvollziehbare Detaillierung aus Schnurbein 2012[9]: „Die Speicherung überschüssigen EE-Stroms durch synthetisches Methan“.
Hinweis.: In den folgenden Kostenangaben sind Strom-Bezugskosten von ca. 12 c / kWh eingerechnet.
Schnurbein 2012[9]. Das „System SNG“ als Langzeitspeicher für überschüssigen EE-Strom würde bei einer Kapazität von 44 GW und einem Stromoutput zwischen 12,3 und 31,7 TWh – das wären 2-5 % des deutschen Strombedarfs – jährliche Mehrkosten zwischen 25,1 und 28,1 Mrd. € verursachen. Auf die Kilowattstunde SNG-Strom gerechnet ergäben sich für den Verbraucher Mehrkosten zwischen 79 und 228 ct/kWh – zuzüglich Steuern. Somit wäre SNG-Strom um den Faktor 10-20 teurer als Strom aus Erdgas.
4 Batteriespeicher
4.1 Allgemeine Betrachtung
In der Niedersachsen-Studie[1] werden Batteriespeicher gar nicht gelistet, da sie als Mengenspeicher viel zu teuer wären.
4.2 Mobile Li-Ionen Batteriespeicher (E-Car) Speicherkosten
Hartmann et al. 2012[24] weist die folgenden Kosten für mobile Li-Ionen-Batteriespeicher aus. Als Investitionskosten sind darin aber nur die reinen Batteriekosten berücksichtigt. Denn man nimmt ja an, dass das E-Auto ein Fahrzeug ist – aber immer, wenn es das Stromnetz „benötigt“ als Stromsenke oder –Lieferant an der Steckdose hängt -.
Kosten für die Speicherung in mobilen Li-Ionen Batterien [24]:
Stand heute
Tagesspeicherbetrieb
· Stromeinspeisungskosten von 37 €ct/kWh mit Strombezugskosten von
4,8 €ct/kWh
Saisonal
· Stromspeicherkosten: 2.270 €ct/kWh
· Stromeinspeisungskosten von 2.275 €ct/kWh mit Strombezugskosten von
4,8 €ct/kWh
Zukunft
Tagesspeicherbetrieb
· Stromeinspeisungskosten auf 19 €ct/kWh mit Strombezugskosten von
4,8 €ct/kWh
Saisonal
· Stromeinspeisungskosten 948 €ct/kWh mit Strombezugskosten von
4,8 €ct/kWh
Akkuspeicher für kleine Solaranlagen
In Energie GmbH 2014[10] ist das folgende Bild (Abbildung 4) mit Kostendarstellungen für kleine Speichereinheiten für Solar-Selbstversorger enthalten. Beachten, dass die Speicherkosten nicht die Kosten des zurückgelieferten Stromes beinhalten, dieser ist zuzurechnen.
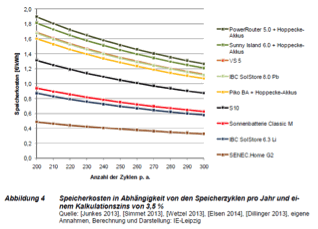
Bild 13.1
Diese Angaben in Energie GmbH 2014[10] gehen aber davon aus, dass innerhalb von 25 Jahren Akku und Wechselrichter nur 1 x ausgetauscht werden müssen (Seite 19). Das ist aber realitätsfremd.
Die Studie sagt dazu (Seite 38):
[10]„An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Ermittlung der Speicherkosten und der Wirtschaftlichkeitsvergleich auf Annahmen und Prognosen beruhen, die in der Realität so nicht eintreffen müssen.“
Aber selbst mit dieser Annahme kommt die Analyse zu dem Schluss (Seite 22):
Energie GmbH 2014[10].„Die Untersuchung hat gezeigt, dass bei einem Kalkulationszinssatz von 3,5 % keines der analysierten Produkte Speicherkosten unter den haushaltstypischen Strombezugskosten aufweist“.
Anmerkung des Verf.: Das sind aber die hohen Stromkosten des Endkunden, nicht die Nettosätze des EEG-Stromes.
.
In Pettinger 2013[23] werden für einen 7 kWh Lithium-Ionen Speicher (passend zu privaten 10 kW PV-Anlagen) reine Speicherkosten ohne Stromkosten von 25 ct / kWh angegeben.
Kostenfazit
Es scheint realistisch, bei Akkusystemen von Kosten im Bereich 0,3 bis 1 EUR / kWh für den zurückgespeisten Strom auszugehen.
Forschungsstand
In F. Endres 2015[8] ist der Stand der Batterieforschung gut dargestellt. Es lohnt sich, das Interview zu lesen. Man kann dann die vielen, oft sehr euphorischen Publizierungen besser einordnen. Auch Heller 2013[22] ist zum Thema realistische Betrachtung der Verbesserungsmöglichkeiten von Akkus lesenswert.
5 Zusammenfassung Stromspeicher
Was sagt die Niedersachsen-Studie
Niedersachsen-Studie 2014[1]. In einem Ausblick für das Jahr 2030 wurden Annahmen getroffen, wie sich die Kennwerte der unterschiedlichen Speichersysteme entwickeln könnten. Diese sind detailliert im entsprechenden Kapitel dargestellt. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass auch 2030 PSW (Anm.: Pumpspeicher-Kraftwerk), gefolgt von AA-CAES (Anm.: Druckluftspeicher) für die Kurz- und Mittelfristspeicherung die kostengünstigste Speichertechnologie ist. Anders als heute schließt jedoch auch in diesen Speicherszenarien der Wasserstoffspeicher auf und verringert den Abstand zu PSW und AA-CAES. Das Bild dreht sich bei einem Einsatz als LFS (Anm.: Langzeitspeicherung). Hier ist 2030 der Wasserstoffspeicher in allen Pfaden die deutlich günstigste Technologie. PSW sind um den Faktor 3 bis 4 teurer.
Zusammenfassend kann folgendes für die Zukunft festgehalten werden: Kommt es zu den dargestellten technologischen Weiterentwicklungen, so stellen Wasserstoffspeicher im Jahr 2030 die günstigste der untersuchten Speichertechnologien dar.
Für Ökostrom-bedingte Mehreinspeisung ist in jedem Fall das „Wegwerfen“ des Stromes die weitaus und auch in Zukunft billigste Lösung.
Für eine Grundlastbereitstellung aus Zwischenspeicherung verdoppelt sich selbst bei der billigsten Speichertechnologie mindestens der Preis für den zurückgelieferten Strom. Ab dann wird es nur teurer.
Man erkennt gut, warum früher niemand auf die Idee kam, Strom in großem Maßstab zwischenzuspeichern.
Der Forschungsstand ist bei den verschiedenen Verfahren sehr unterschiedlich. Im Wesentlichen konzentriert er sich auf die Machbarkeit für Volumensverwendung. Die erzielbaren Verbesserungen sind allerdings schon heute gut quantifizierbar (diese chemischen Verfahren haben nirgends – wie Computer alle paar Jahre – einen Quantensprung an Performanceverbesserung, sondern sind froh, in Jahrzehnten wenige % zu erreichen).
Wer Interesse hat, sich auch über hier nicht gelistete Speichersysteme zu informieren, findet in F. Endres 2015[ 8] eine Übersicht.
Ausblick
Dass sich Speicher derzeit und auch in Zukunft nicht lohnen, wird die Politik nicht ruhen lassen. Weil chemische Speicher auch mit viel Forschung nicht wirklich billiger werden (können), wird man EEG-üblich ein Subventionsmodell kreieren unter dem Slogan „Mehrwert ist zu vergüten“ und den Strombezieher bezahlen lassen. Wie Lösungen dazu aussehen, kann man in FENES, OTH 2013[5] und BE e.V. A. Hauer6] schon nachlesen:
![]()
FENES, OTH 2013[5]
BE e.V. A. Hauer[6].
Steigende Preise der CO2-Zetifikate würden die Wirtschaftlichkeit von Energiespeichern unterstützen!
6 Quellen für Teil 1 – 3
[1]
Niedersachsen-Studie 2014. Innovationszentrum Niedersachsen GmbH, Juli 2014. Studie 7983P01/FICHT-12919463-v19:“Erstellung eines Entwicklungskonzeptes Energiespeicher in Niedersachsen“
[3]
Stellungnahme BUND 2010. BUND, 27. August 2010: „Stellungnahme zur Frage der Stromspeicherung im Rahmen der Netzintegration von Strom aus erneuerbaren Energien“
[4]
Bölkow-Studie 2010. Ludwig_Bölkow_Systemtechnik GmbH (LBST), 22. April 2010: „Energiespeicher in Stromversorgungssystemen mit hohem Anteil Erneuerbarer Energien“
[5]
FENES, OTH 2013. Regensburg 05.11.13: „Energiespeicher für die Energiewende Zusatzkosten vs. Zusatznutzen? Ringvorlesung Kraftakt Energiewende II“
[6]
BE e.V. A. Hauer. Bundesverband Energiespeicher e.V., Andreas Hauer: „Energiespeicher Technologien und Anwendungen“
[7]
VCI Zwischenbericht 2013. Ein Zwischenbericht des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), 8.Oktober 2013: „Zukunft der Energiespeicher“
[8]
F. Endres 2015. TU Clausthal 13.04.2015, Interview mit Prof. Dr. rer. nat. Frank Endres, Institut für Elektrochemie: „Hintergründe zur Energiewende Batterien ohne Power und Windanlagen mit Gesundheitsgefahren“
http://www.deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2015_04_13_dav_aktuelles_interview_energiewende.html
[9]
Schnurbein 2012. Vladimir von Schnurbein: „Die Speicherung überschüssigen EE-Stroms durch synthetisches Methan.“
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 62. Jg. (2012) Heft 9
[10]
Energie GmbH 2014. Leipziger Institut für Energie GmbH, 29. Januar 2014: Kurzexpertise „Wirtschaftlichkeit Batteriespeicher Berechnung der Speicherkosten und Darstellung der Wirtschaftlichkeit ausgewählter Batterie- Speichersysteme“
[11]
Fachausschuss erneuerbare Energien 2010. Fachausschuss ForschungsVerbund Erneuerbare Energien, Juni 2010: „Nachhaltiges Energiesystem 2050 Eine Vision für ein nachhaltiges Energiekonzept auf Basis von Energieeffizienz und 100% erneuerbaren Energien“
[14]
BMUB 2004. BMUB, 30.07.2004 Mitteilung Nr. 231/04: Erneuerbare-Energien-Gesetz tritt in Kraft
http://www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/erneuerbare-energien-gesetz-tritt-in-kraft/
[15]
Ahlborn 2013. Dr. – Ing. Detlef Ahlborn 2. Juli 2013: „Wie viele Windräder braucht das Land?“
[16]
Ahlborn. Blog Vernunftkraft. Dr. – Ing. Detlef Ahlborn, „Windkraft-Verfügbarkeit“
[17]
Agora Energiewende Agorameter: Stromerzeugung und Energieverbrauch
[18]
ScienceScepticalBlog 2013. ScienceScepticalBlog, 25. März 2013: Fred F. Mueller „Aufwind nur für den Strompreis? Deutschlands Energiewende und die Realität“
[19]
BmBF. Bundesministerium für Bildung und Forschung: „Energietechnologien für die Zukunft, Netze und Speicher“.
http://www.bmbf.de/de/16753.php
[20]
NABU 2011. NABU Schleswig-Holstein 5. September 2011. Agrargasanlagen und Maisanbau. Eine kritische Umweltbilanz
[21]
TAB 2012. TAB Arbeitsbericht Nr. 147, April 2012: „Endbericht zum Monitoring: Regenerative Energieträger zur Sicherung der Grundlast in der Stromversorgung“
[22]
Heller 2013. science-skepticalm Peter Heller, 24. November 2013: „Technikfeindlichkeit am Beispiel Elektromobilität“
[23]
Pettinger 2013. Hochschule Landshut 12.08.2013. Prof. Dr. Karl-Heinz Pettinger: „ Batteriespeicherung für Heimanwendungen“
[24]
Hartmann et al. 2012. Stuttgart, 2012: „Stromspeicherpotenziale für Deutschland“
[25]
WIKIPEDIA: Erneuerbare-Energien-Gesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz
[26]
science-skeptical 2014. science-skeptical Blog, 19. Dezember 2014 Artikel: „Ein Fazit zu den Erneuerbaren Energien – Produktion 2014 und ein Blick in die Zukunft“.
Ein Fazit zu den „Erneuerbaren Energien“ – Produktion 2014 und ein Blick in die Zukunft
[27]
EIKE 2015. EIKE Blogbeitrag, 07.03.2015: „Münchner Stadtwerke mal wieder – Burn, burn, Bürgergeld“
http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/muenchner-stadtwerke-mal-wieder-burn-burn-buergergeld/